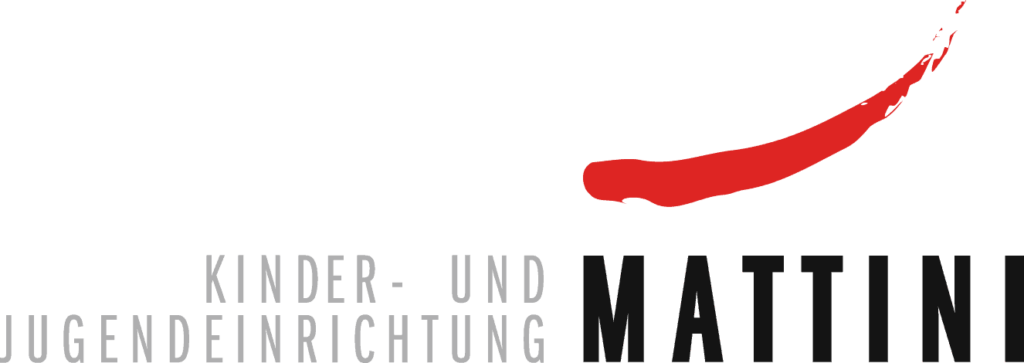Rechtliches
Impressum
Datenschutzerklärung
Phasenmodell der Kinder- und Jugendeinrichtung Mattini
Während des Aufenthalts in der Kinder- und Jugendeinrichtung Mattini wird darauf hingearbeitet, dass der Alltag bestmöglich bewältigt werden kann. Dafür ist es wichtig, Abmachungen zu treffen, die dem Alter und den individuellen Fähigkeiten entsprechen. Je besser der Alltag gelingt und neue Kompetenzen erworben werden, desto mehr Freiheiten und Verantwortung können schrittweise übernommen werden. In Bereichen, in denen dies noch nicht ausreichend gelingt, werden entsprechende Rahmenbedingungen gesetzt und gezielte Unterstützung angeboten, um notwendige Kompetenzen zu trainieren.
Beobachtungs- und Klärungsphase
In der ersten Phase, die etwa vier Monate dauert, geht es vorrangig darum, sich in der Einrichtung einzuleben und eine erste Einschätzung darüber zu erhalten, welche Form der Unterstützung für das Kind/Jugendliche und ihr Umfeld am besten geeignet ist. Diese Zeit dient dazu, die aktuelle Situation besser zu verstehen und herauszufinden, in welchen Bereichen Bedarf an Unterstützung besteht.
Während dieser ersten Zeit wird darauf geachtet, ein stabiles Umfeld zu schaffen, um den Übergang in den neuen Alltag zu erleichtern. Die Abläufe und Regeln der Einrichtung werden kennengelernt und es wird erkundet, wie das Zusammenleben funktioniert. Gleichzeitig verschafft sich das Betreuungsteam ein besseres Bild von den individuellen Stärken, Interessen und Faktoren, die das Wohlbefinden beeinflussen.
Am Ende dieser Phase findet gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten und den beteiligten Fachpersonen eine erste Standortbestimmung statt. Dabei werden die gesammelten Erkenntnisse besprochen und Ziele für die nächste Phase festgelegt. Zudem wird vereinbart, wie das soziale Umfeld bestmöglich unterstützen kann, um eine positive Weiterentwicklung zu fördern.
Das Ziel der Beobachtungs- und Klärungsphase ist die Stabilisierung der aktuellen Situation und die Entwicklung einer klaren Perspektive für den weiteren Weg.
Entwicklungsphase
In der Entwicklungsphase geht es darum, schrittweise Kompetenzen zu erlernen, die dabei helfen, den Alltag erfolgreich zu bewältigen. Diese Phase ist besonders wichtig, da hier die Möglichkeit besteht, individuelle Stärken weiterzuentwickeln und neue Fähigkeiten zu erproben. Der Alltag innerhalb und außerhalb der Wohngruppe dient dabei als Übungsfeld, in dem verschiedene Situationen gemeistert und geeignete Lösungswege gefunden werden können – auch wenn dies herausfordernd sein kann.
Regelmäßige Gespräche mit der Bezugsperson dienen dazu, den Fortschritt zu reflektieren. Dabei wird besprochen, was bereits gut gelingt und in welchen Bereichen weiterhin Entwicklungsbedarf besteht. Gemeinsam mit der betreuten Person und dem sozialen Umfeld wird überlegt, wie die bestmögliche Unterstützung aussehen kann. Falls es in bestimmten Bereichen erforderlich ist, werden zusätzliche Fachpersonen einbezogen.
Ein zentrales Ziel dieser Phase ist die Schaffung der Voraussetzungen für eine mögliche Rückkehr in das familiäre Umfeld. Sollte eine Rückkehr nicht realisierbar sein, wird gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten und den zuständigen Behörden eine alternative Lösung erarbeitet.
Für junge Erwachsene, die sich auf dem Weg in die Selbstständigkeit befinden, gibt es gezielte Unterstützung. Sobald mehr Eigenverantwortung übernommen werden kann, besteht die Möglichkeit, schrittweise mehr Selbstständigkeit zu üben. Dafür stehen in den Wohngruppen sogenannte Progressionszimmer mit eigenem Bad, WC und einer kleinen Küchenzeile zur Verfügung, in denen die Organisation des eigenen Alltags trainiert werden kann.
Zusätzlich gibt es eine Außenwohnung in Brig, die eine noch unabhängigere Vorbereitung auf das eigenständige Wohnen ermöglicht. Dieser Wohnplatz bietet die Möglichkeit, sich schrittweise von der Wohngruppe zu lösen, während weiterhin unterstützende Begleitung gewährleistet wird.
Etwa alle vier Monate finden Standortbestimmungen mit allen Beteiligten statt, um die persönliche Entwicklung und die des sozialen Umfelds zu besprechen. Dabei werden neue Schwerpunkte und Ziele festgelegt, um die bestmögliche Förderung sicherzustellen.
Austrittsphase
Sobald die betreute Person, die Erziehungsberechtigten und die zuständigen Behörden zu dem Schluss kommen, dass die Voraussetzungen für einen Austritt aus der Einrichtung gegeben sind, wird im Rahmen einer Standortbestimmung der Beginn der Austrittsphase festgelegt.
Das Ziel dieser Phase ist ein geplanter und koordinierter Übergang in die neue Lebenssituation sowie eine schrittweise Ablösung vom Unterstützungsangebot der Einrichtung. Die Dauer und die Rahmenbedingungen für diesen Übergang werden gemeinsam mit allen Beteiligten abgestimmt. Falls erforderlich, können in dieser Phase bereits ambulante Unterstützungsangebote, wie beispielsweise sozialpädagogische Familienbegleitung, in den Austrittsprozess integriert werden.
Krisen- und Klärungszone
Nicht immer verläuft der Alltag wie geplant, und schwierige Situationen können auftreten. Sollte es während des Aufenthalts in der Wohngruppe zu grösseren Herausforderungen kommen, kann die sogenannte Krisen- und Klärungszone eingeleitet werden. Dies bedeutet, dass eine intensivere Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation erfolgt, um gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten und den beteiligten Fachpersonen nach Lösungen zu suchen.
Eine Krise kann beispielsweise dann entstehen, wenn eine anhaltend belastende Situation besteht, wiederholte oder massive Regelverletzungen auftreten oder sich grundlegende Veränderungen in der Lebenssituation ergeben. Das Hauptziel dieser Massnahme ist es, herauszufinden, welche Unterstützung benötigt wird, um Stabilität und Sicherheit wiederherzustellen.